„Wir beobachten eine Zersplitterung der Lebensverhältnisse“
Längst nicht alle ländlichen Regionen sind auf dem absteigenden Ast. Was die schrumpfenden Gegenden von den prosperierenden lernen können – und warum sie lernen müssen –, darüber hat der iwd mit dem Soziologieprofessor Rolf G. Heinze von der Ruhr-Universität Bochum gesprochen.
- Regionale Unterschiede bestehen in Deutschland nicht nur zwischen Stadt und Land. Auch im ländlichen Raum gebe es strukturschwache und prosperierende Regionen, sagt Soziologieprofessor Rolf G. Heinze.
- Die Landbevölkerung differenziert sich in die, die bleiben wollen, und jene, die bleiben müssen. Je nachdem, welche Kategorie überwiegt, entwickeln sich auch das Wohlstandsniveau der ländlichen Räume und ihre Infrastruktur unterschiedlich.
- Um die Lebensqualität in Regionen mit schrumpfender und alternder Bevölkerung zu verbessern, gibt es verschiedene Ansatzpunkte, vom Telehealth-Monitoring über Nachbarschaftsnetzwerke bis hin zum Ausbau von Kleinstädten zu regionalen Ankerpunkten mit guter medizinischer Versorgung.
Professor Heinze, während die Städte in Deutschland boomen, verlieren ohnehin schon dünn besiedelte Regionen Einwohner und werden für junge Menschen immer unattraktiver. Kann man da noch von einheitlichen Lebensverhältnissen sprechen?
Die regionalen Unterschiede wachsen in der Tat. Aber diese Feststellung auf den Unterschied zwischen Stadt und Land zu begrenzen, greift viel zu kurz. Man muss schon genau hinschauen: Es gibt offensichtlich abgehängte Landstriche, insbesondere im Osten Deutschlands, aber nicht jede dünn besiedelte Region ist auch strukturschwach und überaltert.
Welches sind denn die positiven Beispiele?
Dass es dem Münchener Umland gut geht, ist bekannt und auch nicht erstaunlich. Weniger geläufig ist vielleicht, dass Olpe und Gütersloh in Nordrhein-Westfalen zu den prosperierenden Kreisen gehören. Gütersloh profitiert von der Strahlkraft des Bertelsmann-Konzerns. Olpe ist zum einen Erholungsregion im Sauerland, zum anderen sind dort aber auch einige mittelständische Unternehmen ansässig. In Niedersachsen sind das Emsland sowie die Nachbarkreise Cloppenburg und Vechta so jung wie die Universitätsstadt Freiburg.
Es kann im selben Kreis schrumpfende und wachsende Orte geben, so wie es auch in Städten abgehängte und angesagte Viertel gibt.
Vielerorts bringt eine solche Betrachtung auf Kreisebene aber nicht genug Erkenntnisgewinn. Wir beobachten nämlich eine regelrechte Zersplitterung der Lebensverhältnisse. Es kann sogar im selben Kreis schrumpfende und wachsende Orte geben, so wie es eben auch in Städten abgehängte und angesagte Viertel gibt.
Zudem ist Landbewohner nicht gleich Landbewohner. Die soziale Ähnlichkeit verliert sich mehr und mehr. Die Landbevölkerung differenziert sich in die, die bleiben wollen, und jene, die bleiben müssen. Je nachdem, welche Kategorie überwiegt, entwickeln sich auch das Wohlstandsniveau der ländlichen Räume und ihre Infrastruktur höchst unterschiedlich.
Was machen die prosperierenden ländlichen Regionen richtig und die strukturschwachen falsch?
Von richtig und falsch würde ich gar nicht unbedingt sprechen. Schwierigkeiten haben gerade Regionen mit einem hohen Anteil von Einfamilienhäusern – aber das ist in Deutschland nun einmal die beliebteste Wohnform. Die Einfamilienhaussiedlungen sind oft von einer kollektiven Alterung betroffen, weil die Bewohner zu einer ähnlichen Zeit als junge Familie eingezogen sind und dann nicht mehr weggehen.
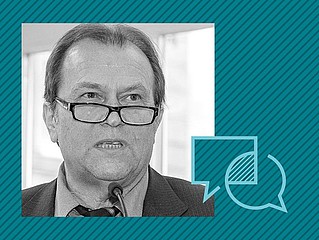 Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass ältere Menschen ungern umziehen. Viele 65- bis 85-Jährige wohnen schon sehr lange im gleichen Umfeld: Fast ein Drittel von ihnen lebt seit mehr als 40 Jahren an einem Ort. Diese Sesshaftigkeit ist generell bei Wohneigentümern wesentlich ausgeprägter als bei Mietern. Und auf dem Land zählt eben das Gros der Älteren zu den Hausbesitzern.
Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass ältere Menschen ungern umziehen. Viele 65- bis 85-Jährige wohnen schon sehr lange im gleichen Umfeld: Fast ein Drittel von ihnen lebt seit mehr als 40 Jahren an einem Ort. Diese Sesshaftigkeit ist generell bei Wohneigentümern wesentlich ausgeprägter als bei Mietern. Und auf dem Land zählt eben das Gros der Älteren zu den Hausbesitzern.
In meinen Augen ist es ein Gebot der Menschlichkeit, Lösungen zu finden, die es älteren Menschen ermöglichen, in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben – auch auf dem Land. Zumal viele von ihnen auch gar nicht umziehen können, selbst wenn sie wollten.
Was meinen Sie damit?
In alternden Einfamilienhausgebieten liegt oft vieles im Argen. Es gibt zu wenige Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist häufig schlecht. Die sogenannte Daseinsvorsorge ist also nicht mehr gewährleistet. Das wiederum führt dazu, dass die Immobilienpreise fallen und sich die Häuser nicht zu einem Betrag verkaufen lassen, der ihren Besitzern den eigentlich ratsamen Umzug in eine besser versorgte Gemeinde ermöglichen würde. Vor allem einkommensschwache Haushalte sind in ihren unsanierten und nicht altengerechten Häusern regelrecht gefangen.
Wie ist denn den betroffenen Menschen und Orten zu helfen?
Potenzial liegt auf jeden Fall in der Digitalisierung. Es muss in unterversorgten Regionen möglich sein, Einkäufe und Bankaufträge online zu erledigen und auch bestimmte Gesundheitsdienstleistungen übers Netz zu erhalten, etwa eine Betreuung für Diabeteskranke. Wir müssen außerdem altengerechte technische Assistenzsysteme nutzen, die etwa einen flächendeckenden Notruf und Erinnerungsfunktionen für Menschen ohne Smartphone bieten sowie Sturzerkennungsmelder sein können. Das kann bis zu einem regelrechten Telehealth-Monitoring reichen, mit dem sich unter anderem Vitalparameter wie das EKG von Risikopatienten überwachen lassen.
Die Technik soll es also richten.
Nein, sie muss unterstützen. Wir brauchen auch funktionierende Nachbarschaftsnetzwerke – und zwar sowohl ganz klassisch analog als auch digital. Außerdem könnte eine integrierte Gesundheitsversorgung – bei der zum Beispiel der Hausarzt oder eine Pflegeeinrichtung alle erforderlichen Gesundheitsdienstleistungen koordiniert – in den Wohnquartieren dazu beitragen, dass ältere Menschen auf dem Land möglichst lange zu Hause bleiben können. Die Niederländer sind hier schon recht weit.
Darüber hinaus ist natürlich eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit nötig. Um das Wohnumfeld und die Lebensqualität des älteren Teils der Bevölkerung zu verbessern, sollten Kleinstädte in der Region zu sogenannten Ankerpunkten ausgebaut werden, in denen die medizinische Versorgung bereitsteht und zu denen sich ein Fahrdienst organisieren lässt. Solche regionalen Zentren mit ihrem größeren Angebot können auch für junge Familien attraktiver sein als so manch eine Großstadt.
Um das Wohnumfeld und die Lebensqualität des älteren Teils der Bevölkerung zu verbessern, sollten Kleinstädte in der Region zu sogenannten Ankerpunkten ausgebaut werden.
Wie gelingt es, dass in einer Region alle an einem Strang ziehen?
Es steht und fällt am Ende mit den Menschen vor Ort. Eine besondere Rolle kommt oft einzelnen engagierten Personen wie dem Bürgermeister, dem Pfarrer oder einem lokalen Unternehmer zu, die im Zentrum verschiedener Netzwerke sitzen und mit ihrem Engagement die Fäden zusammenhalten. Wie gut solche regionalen Netzwerke funktionieren können und dass man dabei auch die Rolle der Kirche nicht unterschätzen darf, zeigt sehr anschaulich die Emslandstudie des Berlin-Instituts aus dem Jahr 2017.
Diese Studie hat am Beispiel des Emslands herausgearbeitet, wie eine periphere ländliche Region für junge Menschen und Familien attraktiv bleibt. Davon profitieren dann auch die Älteren in der Gegend.
Und was ist das Geheimnis des Emslands?
Seine Menschen. Spaß beiseite: Die Emsländer sind heimatverbunden und haben eine zupackende Art. Aber diese Heimatverbundenheit fällt nur im übertragenen Sinn vom Himmel. Sie entwickelt sich von Kindesbeinen an, etwa in den Sportvereinen oder durch die Kirche, die im katholischen Teil Niedersachsens einen besonders hohen Stellenwert genießt. Viele Emsländer wachsen so in Ehrenämter hinein und sind auch in der Nachbarschaftshilfe sehr engagiert. Das große Potenzial an Eigeninitiative wird aber auf übergeordneten Ebenen kanalisiert und auch finanziell unterstützt. Es gibt hauptamtliche Ansprechpartner in den Kirchengemeinden und den Kommunen. Lokale Unternehmen helfen mit Spenden und Sponsoring.
Klingt nach einem Landleben aus dem Bilderbuch.
Der demografische Wandel geht auch am Emsland nicht vorbei. Auch dort steigt der Anteil älterer Menschen. Ein Ziel – nicht nur für das Emsland, sondern generell in dünn besiedelten Regionen – sollte es sein, den Tatendrang der jungen Älteren zu nutzen und diese 60- bis etwa 75-Jährigen ihren Kräften entsprechend in ehrenamtliche Aufgaben einzubeziehen, zum Beispiel als Begleiter für andere Senioren oder auch als Paten für Flüchtlinge.
